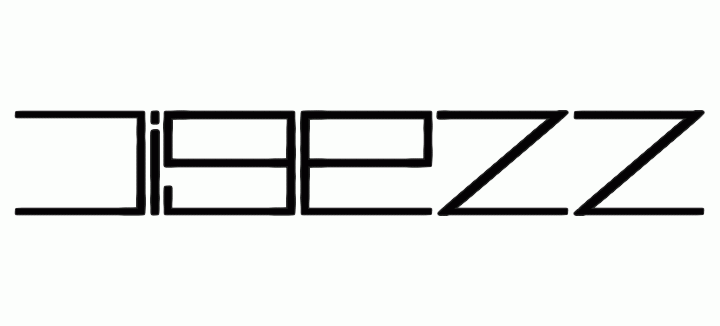Anfangs dieses Jahres habe ich ihn geschrieben, den Text. Einfach so. Weil ich gerne schreibe. Weil ich gerne mit Worten spiele und diese gerne zu Sätzen arrangiere. Den Text hatte ich noch vor dem Beginn des 2. Semesters fertig gestellt. Also in einer Zeit, da Digezz nur ein Wort war. Aus dem Wort wurde einige Wochen später ein Arbeitsauftrag und aus den Worten im Text sollte meine Arbeit werden.
Motivation
Es sollte mein erster Film werden, in dem weder die Zeit, noch der Interviewpartner, noch das Wetter oder der Zufall Regie führten. Bei diesem Film wollte ich Regie führen.
Ich wollte möglichst vieles ausprobieren und so beschloss ich, einfach all das zu machen, was ich vorher noch nie gemacht hatte. Ich filmte das erste Mal mit meiner neuen Sony a7sII. Ich filmte das erste Mal mit den Videoeinstellungen SLOG3. Ich filmte und schnitt das erste Mal in 4K. Ich arbeitete das erste Mal nach einem Drehplan. Ich beleuchtete das erste Mal bewusst einzelne Szenen aus. Und ich führte, das erste Mal ein richtiges Color Grading durch.
Prozess - Vom Text zum Film
Für jede Textstelle überlegte ich mir ein Bild. Mit der Fotokamera zog ich durch Chur und suchte nach den best möglichen Einstellungen. Eine Bedingung stand von Anfang an fest. Mein Protagonist musste in der Mitte stehen. Er musste in der Mitte sitzen. Er musste durch die Mitte gehen. Die Bilder sollten absolut symmetrisch sein. Sie mussten etwas Ruhiges und Nachdenkliches ausstrahlen. Ein wenig nach dem Vorbild von Lars von Triers "Melancholia". Entstanden sind etwa 20 Bilder. In diese fügte ich die Silhouette eines Mannes ein und bearbeitete die Aufnahmen so, wie ich sie im Film haben wollte.
In einem nächsten Schritt stand mir meine Kollegin Modell. Ich realisierte an den gleichen Orten einige Probeaufnahmen. Dieses Mal in bewegten Bildern. Diese Aufnahmen schnitt ich zu einem ersten Probefilm zusammen und machte mich ans "Probe" - Color Grading.
Die technischen Dinge schienen vorerst geklärt und so machte ich mich auf die Suche nach einem Protagonisten. Dank meinen Mitstudenten fand ich Willy Hochstrasser. Als ich ihm den Text mailte, schrieb er etwas schockiert zurück. Der Text schien ihm zu negativ. Er erlebe das Alter als äusserst positiv. Er lebe mit seiner Frau zusammen, engagiere sich unter anderem im Theater und besuche manchmal Vorlesungen an der Senioren-Uni in Zürich. Etwas besorgt, mein einziger Schauspieler könnte vielleicht doch noch abspringen, schrieb ich ihm ein längeres Mail und erklärte, was ich mit dem Text aussagen wollte. Schlussendlich versprach ich ihm, einige Stellen zu streichen und durch positive Sätze zu ergänzen.
Heute bin ich froh, auf ihn gehört zu haben. Der Text hat nichts an Ernsthaftigkeit eingebüsst und doch blicken immer wieder die positiven Seiten durch. Zudem hätte ich nicht hinter dem Film stehen können, wenn mein Protagonist nicht hinter dem Text hätte stehen können.
Im März drehte ich die Aufnahmen des Baches. Etwas später dann, in einem Pfadilager, borgte mir Claude Roseng sein Gesicht für die kurze Rückblende im Spiegel. Meine Schwester lieh mir ihre Hände und Füsse und rannte mit mir einige Male quer über den Fussballplatz.
Dann endlich traf ich mich das erste Mal mit meinem Protagonisten Willy Hochstrasser und eine Woche später, am 20. April war der grosse Drehtag. Willy Hochstrasser wusste, worauf es mir ankam und so arbeiteten wir uns speditiv von einer Szene zur nächsten durch. Am Nachmittag drehten wir mit meinen zwei Mitbewohnern die Schlussszene im Park. Schliesslich übernahm die Zeit doch noch das Zepter und zwang uns zur Eile. Mein Protagonist hatte am späten Nachmittag einen weiteren Termin und so blieb für die Audioaufnahme des Textes im Radiostudio des Medienhauses fast keine Zeit. Eine Aufnahme musste genügen, bevor wir zurück in die Stadt fuhren und den Drehtag beendeten.
Schliesslich machte ich mich an den Schnitt und die schwierige Suche nach einem passenden Klavierstück. Einen Monat später, Ende Mai, war das Projekt "Die, die noch da sind" fertig.
Selbstkritik
Grundsätzlich kann ich hinter dem Produkt stehen. Ich bin zufrieden und meine Hauptziele habe ich erreicht. Ich hielt mich grösstenteils an den Drehplan und liess mir das Heft nicht von äusseren Umständen aus der Hand nehmen. Einiges hätte ich besser machen können und einige Probleme frassen rückblickend viel Zeit auf.
Für die Rückblende im Spiegel hätte ich unbedingt ein Stativ benutzen sollen. Ich liess mich von den Umständen im Pfadilager zur Eile verleiten und so sass ich für eine lange Zeit am Schnitt und versuchte das Bild "im Spiegel" einigermassen zu stabilisieren. Schlussendlich nahm ich dann trotzdem nur ein Standbild.
Ich ging zu optimistisch ins Tonstudio. Weder wusste ich, wie die Anlagen richtig bedient werden mussten, noch hatte ich einen Plan B, sollte etwas im Tonstudio nicht klappen. Zum Glück half mir spontan ein Student aus dem 4 Semester. Weiter war der Zeitstress zum Schluss des Drehtages ärgerlich. So musste der Ton bei der ersten Aufnahme klappen und erreichte leider nicht die Qualität, die ich mir erwünscht hatte.
Dem Zeitdruck zum Opfer viel auch die Schlussszene, in der meine zwei Kollegen davongehen. Diese musste ich einige Wochen später nachdrehen, so dass sich das ganze Projekt unnötig verzögerte.
Zwei wichtige Drehorte, welche ich vor dem Drehtag ausgesucht hatte, waren wegen eines Feuers und einer Veranstaltung nicht benutzbar. So fehlten mir schlussendlich zwei symmetrische Einstellungen.
Ein grosses Problem war die Leistung meines Computers. Zur Verfügung stand mir lediglich mein dreijähriges Macbook Air. Das gute Teil war definitiv nicht gebaut worden, um 4K Filme zu schneiden. Eine Szene in bewegten Bildern zu betrachten war nicht möglich und so schnitt ich den kompletten Film in Standbildern. Wollte ich die Wirkung betrachten, musste ich das Projekt erst exportieren.
Szenen, in denen ich mehrere Aufnahmen ineinander kopieren musste, wie zum Beispiel der Rückblick im Spiegel oder der Wald vor dem Fenster, brachten den Computer an den Rand des Zusammenbruchs. Es brauchte sehr viel Zeit, den Film zu schneiden und doch war es mir sehr wichtig, am Ende ein Film in 4K zu exportieren.
Ein weiteres Problem war das Licht. An den dunklen Orten musste ich meinen Protagonisten ausleuchten. Da ich alleine filmte, stellte ich mich mit dem Licht neben Herrn Hochstrasser, leuchtete ihm für eine halbe Minute ins Gesicht und zog mich dann für weitere 30 Sekunden aus dem Bild zurück. In der Post-production schnitt ich dann die zwei Bilder ineinander, so dass nur noch der beleuchtete Protagonist zu sehen ist. Mangels einer nennenswerten Lampe ist er in einigen Bildern noch zu dunkel. Das nächste Mal müsste ich geeignetes Material früher reservieren.
Viele weitere Details könnte man hier natürlich noch anfügen. Insbesondere, diese zu lang geratene Reflexion. Doch was einmal geschrieben ist, kann ich unmöglich löschen. So ist es eben... Viel Spass mit dem Film.